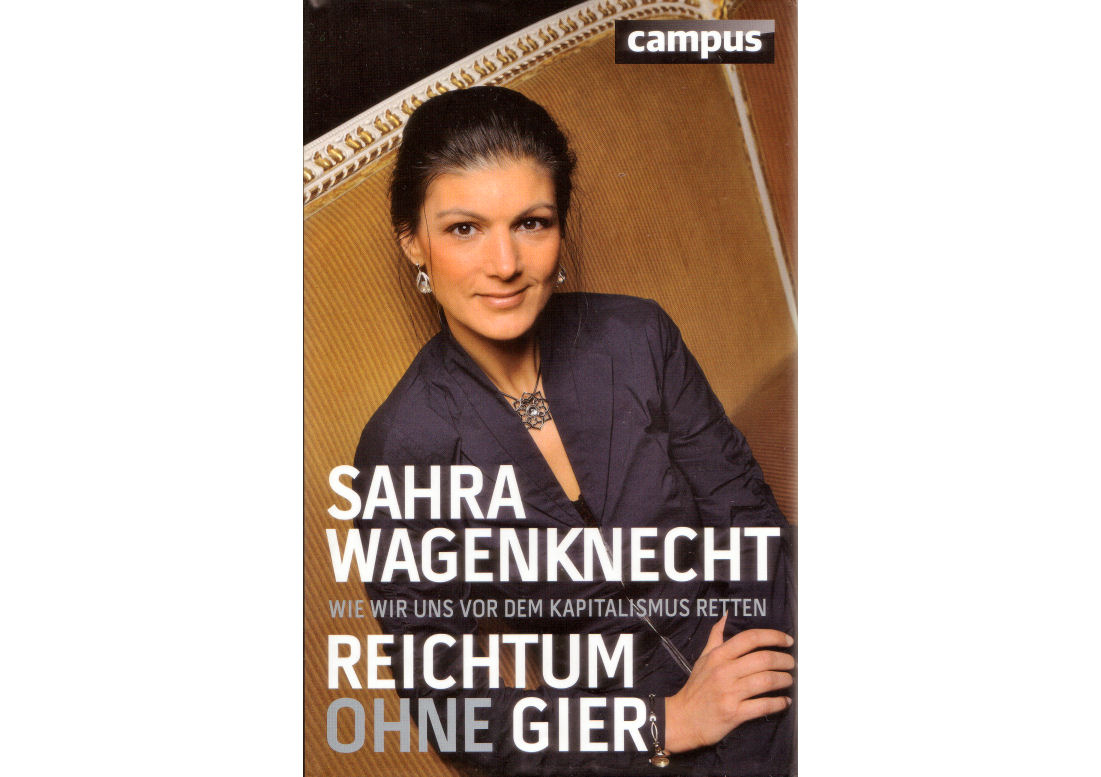Natürlich hat die Linke in der kapitalistischen Gesellschaft eine Aufgabe: für einen sozialen Ausgleich zu sorgen, der nicht automatisch zu Stande kommt, und darauf zu achten, dass die Regulierungsfunktion des Staates nicht zu sehr beschnitten wird, weil dann nämlich Banken- und Finanzkrisen drohen. Doch meist reicht den Linken diese Aufgabe nicht aus, und sie träumen von einer anderen Gesellschaft, eine, die ohne die Gebrechen des Kapitalismus auskommt und allen Menschen eine helle Zukunft bereitet. Von ähnlichen Überlegungen scheint auch der Titel des Buches von Sarah Wagenknecht auszugehen: Reichtum, ja!, negative Erscheinungen wie Gier, nein! Nach diesem Schema ließen sich zig Gesellschaften entwerfen, die zwar schön wären, aber nicht funktionierten.
Aber genau in diesen Fehler verfällt die Autorin nicht. Sie geht nämlich von der modernen kapitalistischen Gesellschaft aus, analysiert, was sich bewährt hat und wo sie ihrem eigenen Anspruch, eine Wettbewerbs- und Leistungsgesellschaft zu sein, nicht gerecht wird.
Die ersten vierzig Seiten einschließlich des Vorwortes lesen sich noch relativ glatt und wenig spannend. Da ist viel von Ungleichheit, von Stagnation und den negativen Folgen des Kapitalismus die Rede. Selbst die mäßige Nachfrage nach Elektroautos, die einfach zu teuer sind, obwohl die Sonne viel mehr Energie zur Erde schickt, als wir benötigen, wird dem Kapitalismus, oder besser gesagt, dem heutigen Kapitalismus, angelastet. Teilweise hat man den Eindruck, hier spricht eine Politikerin, die in Opposition zum Bestehenden steht und deshalb so reden muss. Auch dass Wagenknecht die EU wegen ihrer Demokratiedefizite (S. 24 „Es ist daher auch kein Zufall, dass etwa in Berlin auf einen Abgeordneten acht Lobbyisten kommen, das Verhältnis in Brüssel dagegen bei eins zu zwanzig liegt. Wo demokratische Kontrolle versagt, gedeiht der Sumpf der Korruption und gekaufter Politik.“) gleich ganz beseitigen und durch zwischenstaatliche Verträge ersetzen will, gehört in diese Kategorie.
Aber dann, ab S. 52, als sie beginnt, den Kapitalismus als Leistungsgesellschaft zu analysieren, verlässt sie ihren Standpunkt als Oppositionspolitiker und steigt tiefer in die Materie ein. Jetzt lehnt sie sich an Joseph Schumpeter an, der schon einen Unterschied zwischen einen Unternehmer und einem Kapitalisten gezogen hat. Der eine arbeitet in und für sein Unternehmen und der andere möchte nur abkassieren. Er möchte sein nicht unbeträchtliches Vermögen noch vermehren, indem er wenig tut, oder, wie der Volksmund sagt, sein Geld für sich arbeiten lässt. Letztlich hat das nichts mehr mit persönlicher Lebensleistung zu tun, wie selbst noch bei den äußerst gut verdienenden, fachlichen Spitzenkräften in Konzernen und Banken. Es ist ein Überbleibsel aus dem Feudalismus und Wagenknecht nennt das deshalb Kapital-Feudalismus. Je ausgeprägter der sogenannte Geldadel ist, je weiter also die Schere zwischen arm und reich in einzelnen Ländern auseinanderklafft, desto beschwerlicher ist der Weg von unten nach oben, desto mehr wird die soziale Mobilität eingeschränkt. In den USA, aber auch in Chile, Brasilien und in anderen Staaten ist das gut zu beobachten. Die Gesellschaften verlieren an Potential. Desinteresse und Stagnation machen sich breit. Die Überzeugung, dass es sich lohnt, hart zu arbeiten, schwindet.
Was sehr angenehm bei Wagenknecht auffällt, dass sie überhaupt nicht von Umverteilung spricht, wie oft von linken Politikern zu hören ist, sondern dass es ihr vor allem darum geht, die bestehende Gesellschaft von Hindernissen zu befreien. Wettbewerb unter den Firmen sollte aufrecht erhalten und befördert werden, ebenso Unternehmensgeist. Der kann sich auch in privaten Firmen engagieren. (Also keine Gesamt-Vergesellschaftung der Produktionsmittel mehr!) Monopolisierungen sowohl in der Wirtschaft, als auch bei den Banken und beim großen Geld sollten immer wieder versucht werden, aufzubrechen. Zwar trägt ihr Buch den Untertitel „Wie wir uns vor dem Kapitalismus retten“, doch eigentlich müsste er heißen: „Wie wir den Kapitalismus retten können“. Das würde vermutlich Vorurteile in der Bevölkerung gegen die Linken abbauen, aber natürlich Aversionen bei linken Kräften selbst (oder die sich links nennen) schüren.
Im zweiten Teil des Buches wendet sich Wagenknecht ihren Vorschlägen zu, im wesentlichen zwei, mit denen sie ihre Ziele erreichen möchte. Erstens, Geld zum wirklich öffentlichen Gut zu machen. Das zöge u.a. nach sich, dass der Investment- und Geschäftsbankenbereich getrennt werden würde. Als Geschäftsbank vergibt eine Bank lediglich Kredite und spekuliert nicht mit ihren Einlagen und dem öffentlichen Gut: Geld. Als Investment-Bank darf eine Bank spekulieren, aber dann sollten es die Kunden auch wissen und ebenfalls darüber informiert sein, dass im Konkursfalle diese Bank keinen Anspruch hat, mit staatlichen Mitteln gerettet zu werden. Dieses Banken-Modell wurde in den USA zu Beginn dreißiger Jahre des vorigen Jahrhunderts erfolgreich installiert und verhinderte große Banken- und Finanzkrisen, bis es in den achtziger Jahren aufgeweicht wurde.
Der zweite Vorschlag von Wagenknecht betrifft die Eigentumsformen von großen Betrieben und Konzernen im Kapitalismus. An der Aktiengesellschaft bemängelt Wagenknecht, dass das Risiko für die Aktienemittenten im Konkursfall sehr begrenzt ist, sie müssen nicht mit ihrem persönlichen Vermögen haften, anders als Einzelunternehmer oder persönlich haftende Gesellschafter. Sie formuliert: Begrenztes Risiko, unbegrenzte Gewinne. Für mittlere Betriebe sollte es deshalb Mitarbeitergesellschaften geben und für Großbetriebe sollte es die Form der öffentlichen Gesellschaft sein. Diese könnten wie eine Stiftung geführt werden. Vorbild dafür ist Wagenknecht die Carl-Zeiss-Stiftung in Jena, die im Stiftungsstatut nicht als Ziel einen möglichst hohen Gewinn festlegt, sondern „die Steigerung eines wirtschaftlichen Gesamtertrages“, der sowohl den Fortbestand der Stiftung sichert (wozu Bildung von Reserven gehört) als auch den Mitarbeitern und gemeinnützigen Zwecken zu Gute kommt.
Wagenknecht zeigt eine außerordentlich gute Literaturkenntnis der Dinge, über die sie spricht. Nur manchmal hat man den Eindruck, dass sie nicht ganz diese Bücher, die sie anführt, alle gelesen hat. Sie lobt zum Beispiel das Ministerium für Internationalen Handel und Industrie (MITI) in Japan, das bis zum Beginn der achtziger Jahre den Großunternehmen ziemlich genaue Vorgaben zu Schwerpunkten und Produktentwicklungen machte, verbunden mit einer direkten staatlichen Kreditsteuerung. Und sie meint, so eine Institution müsste man wieder aufleben lassen. Doch der Einfluss des MITI wurde nicht wegen neoliberaler Wirtschaftspolitik begrenzt, sondern weil die Wirtschaft Japans einer starken Kreditlenkung entwachsen war.
Auf alle Fälle sind Sahras Wagenknecht Vorschläge so bedeutsam, dass es sich lohnt, in weiteren Artikeln über sie und damit verbundene Probleme zu diskutieren.