Buchbesprechung: Wolfgang Münchau: Kaputt. Das Ende des deutschen Wirtschaftswunders. Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2025, eBook 256 Seiten, (für gebundenes Buch 22,00 Euro)
Wolfgang Münchau ist ein deutscher Wirtschafts-Publizist, der derzeit in Großbritannien lebt und der von 2001 bis 2003 Chefredakteur des Financial Times Deutschland war. Dessen Grundthese ist in dem vorliegenden Buch, dass Deutschlands Wirtschaftsmodell veraltet ist und deshalb in eine tiefe Krise seit Anfang der 2020er Jahre gerutscht ist. Er widerspricht der Auffassung, dass seit Beginn des Ukrainekrieges allein die fehlenden Gas- und Erdöllieferungen aus Russland, die sehr preisgünstig waren, für die Krise verantwortlich sind, sondern dass sie nur ein verstärkendes Moment darstellen. Ebenso sind die US-Zölle von Trump auf deutsche Industrie-Exporte ein verstärkendes Moment und nicht die Ursache der Krise.
S. 209: „Trumps Zölle sind eine brutale Art, das Problem der Ungleichgewichte anzugehen, und werden am Ende wahrscheinlich auch nicht das erreichen, was er versprochen hat, nämlich eine Rückkehr der amerikanischen Industrie. Aber einen Erfolg, wenn man das so nennen darf, wird diese Politik haben: Sie wird die neomerkantilistisch geprägten Wirtschaftssysteme Deutschlands und Chinas kräftig zurückstutzen.“
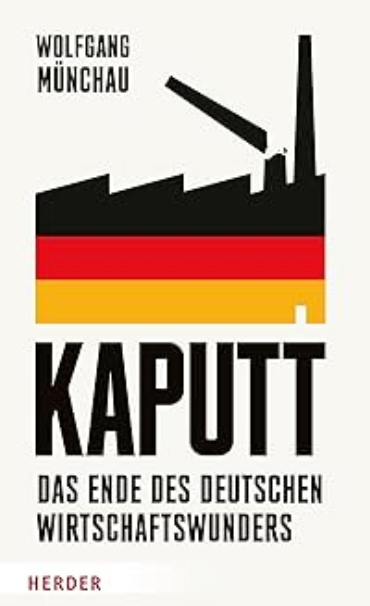
Damit sind wir bei einem Lieblingsthema des Autors (das ist nicht negativ gemeint): dem neomerkantilistischen Wirtschaftsmodell Deutschlands. Gemeint ist damit, große Exportüberschüsse zu erreichen und die Politik des Staates ganz in diesen Dienst zu stellen, gleichgültig ob dadurch eine übergroße Abhängigkeit von anderen Ländern entsteht (in der Vergangenheit Russland und China). Dieses Wirtschaftsmodell zusammen mit dem Ordoliberalismus macht der Autor auch dafür verantwortlich, dass Deutschland die Digitalisierung förmlich verschlafen hat, bzw. dass disruptive Technologien in Deutschland wenig Fuß fassen konnten. Der Staat und die Wirtschaft waren zu sehr auf die Herstellung dinglicher Waren und deren Export ausgerichtet.
Einen größeren Teil in dem Buch nimmt ein, wie sich Deutschland in eine übergroße Abhängigkeit von Russland bezüglich Gas- und Öllieferungen sowie Metall-Importen manövrierte und die Wirtschaftsbeziehungen mit China ausbaute, und dabei regelrecht Know-how an chinesische Firmen weitergab. Münchau meint dazu:
„Ein Mangel an geopolitischem Denken ist ein weitverbreitetes Charakteristikum der deutschen politischen Elite, weil sie alle möglichen politischen Risiken externalisieren. Exporte sind von der Hermes-Warenkreditversicherung der Regierung vollständig abgedeckt, und die NATO kümmert sich um alles andere. Wozu die Mühe? Solange die Regierung weiterhin dabei hilft, den Weg für lukrative Geschäfte freizumachen, ist doch alles gut.“ (S. 126)
Abschließend zu den beiden Kapiteln über Russland und China gibt Münchau seine generelle Einschätzung wider:
„Dies ist keine Moralgeschichte, und ich beschwere mich nicht über Unternehmen, die Geschäftschancen wittern. Ich vermeide hier auch mit höchster Sorgfalt jegliche Diskussion darüber, ob die Außenpolitik den Fußstapfen der Realismusdiplomatie des 20. Jahrhunderts folgen sollte und, wenn ja, wie weit. Ich stehe dem Aufoktroyieren unserer Standards und Werte auf andere generell skeptisch gegenüber, aber glaube fest daran, dass die Vereinbarkeit mit internationalem Recht etwas ist, auf das wir in unserer Handlungspolitik bestehen sollten.“ (S. 146)
Doch diese Meinung kann ich als Leser nicht vollständig teilen. Denn so richtig es ist, keine übermäßige Abhängigkeiten im Handel entstehen zu lassen, so kann die Wahrung des internationalen Rechts nicht alleinige Richtschnur sein. Wir dürften dann keine Handelsbeziehungen zu Israel unterhalten und müssten uns im Handel mit den USA unter Trump sehr zurückhalten.
Überhaupt scheinen mir die beiden Kapitel über die Abhängigkeit Deutschlands von Russland (in der Vergangenheit) und China unausgewogen, denn wo ist das Kapitel, in dem Münchau die übermäßige Abhängigkeit Deutschlands von den USA kritisch anspricht? Es fehlt!
Inzwischen ist China in die neomerkantilistischen Fußstapfen Deutschlands eingetreten, und Deutschland ist von China abhängiger als umgekehrt. Münchau macht das an der Größe der Exporte verglichen mit den Importen fest (die Importe sind wesentlich größer als die Exporte). Nun ist China in Industrien eingebrochen, die eine Domäne Deutschlands waren (Auto, Maschinenbau), macht es sogar besser als Deutschland, indem es versucht, übermäßige Abhängigkeit zu vermeiden. Deutschland hingegen hat es verpasst, sich rechtzeitig umzustellen, und hat viel zu lange an seinen bisherigen Industrien festgehalten. Verantwortlich für solches Handeln sind auch solche Dinge wie die Schuldenbremse für den Staatshaushalt, die reichliche Investitionen in neue Industrien verhinderte, weil im Krisenfall zuerst an den Investitionen gespart wurde, um die Schulden nicht anwachsen zu lassen. Münchau meint aber, eine goldene Regel besage, dass man für Investitionen auch mal Schulden aufnehmen dürfe, weil die wertsteigernd wirkten und sich in Zukunft auszahlten. Ansonsten sei natürlich eine Begrenzung der Staatskredite in Ordnung, besonders für konsumtive Ausgaben.
Ebenfalls einen größeren Raum in dem Buch nimmt die Frage ein, was die deutschen Firmen mit ihren Beträgen aus den Exporten in der Vergangenheit gemacht haben, oder anders gefragt: Wie wurden die Überschüsse aus der Leistungsbilanz angelegt? Das nach Münchau Schlimme, sie wurden in die Industrien angelegt oder neuangelegt, aus denen sie selber kommen. Konkret Münchau:
„Stattdessen reinvestieren deren Erzeuger, die Unternehmen, diese im Ausland. Das wäre auch eine großartige Entscheidung gewesen, hätten sie in Sektoren oder Technologien investiert, mit denen sie nicht vertraut sind. Das aber ist nicht passiert. Deutsche Autohersteller haben in Autofabriken investiert. Sie hätten einen Anteil ihrer riesigen Profite in Unternehmen investieren können, die E-Autos oder Akkus herstellen; wenn sie richtig klug gewesen wären, hätten sie in den öffentlichen Nahverkehr investieren können. Man kann niemandem vorwerfen, wer er ist: VW wird niemals Tesla sein. Das Unternehmen hätten aber auf Nummer sicher gehen und klug investieren können. Auch wenn man sich selbst als Technikmuffel aus der analogen Zeit bezeichnet, kann man von neuer Technologie profitieren, indem man zum stillen Investor in der digitalen Welt wird. Man sollte aber keinesfalls das Risiko verdoppeln. Das Zauberwort hier: Risikomanagement durch Diversifizierung.“ (S. 154/155)
Interessant ist auch das Nachwort von Münchau in der deutschen Ausgabe, denn da geht er auf aktuelle politische Entwicklungen in Deutschland ein, insbesondere nach der Bundestagswahl im Februar 2025. Er spricht davon, dass zwar die CDU/CSU die Wahl erwartungsgemäß gewann, aber mit einem schwachen Ergebnis. Das zwang die „christlichen“ Parteien eine Koalition mit der SPD einzugehen. Doch in dem neuen Bundestag hatten die bürgerlichen Parteien keine Zweidrittelmehrheit mehr – im alten, der noch bis zum Zusammentreten des neuen Bundestages galt, schon. Das zwang die Koalitionäre zur Eile für eine Grundrechtsänderung. Dazu die Einschätzung Münchaus:
„Die Parteien der Mitte nutzten diese vermutlich letzte Gelegenheit für eine mit heißer Nadel gestrickte Reform der Schuldenbremse. CDU/CDU und SPD einigten sich darauf, ein neues 500 Milliarden schweres Sondervermögen für Investitionen in das Grundgesetz zu schreiben und den Mechanismus der Schuldenbremse in einem Punkt zu reformieren: Verteidigungsausgaben von über einem Prozent des BIP werden von den Schuldenregeln ausgenommen. Das ist im Grunde eine schlechte Regel, denn Verteidigungsausgaben sind größtenteils konsumtiv. […] Die neue Regel ist unverhältnismäßig locker. Eine intelligente Reform der Schuldenbremse mit dem Ziel langfristiger Nachhaltigkeit der Schulden ist immer noch nicht erreicht.“ (S. 208)
Ein bedenkenswertes Buch von Wolfgang Münchau mit vielen interessanten Anmerkungen!

